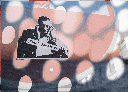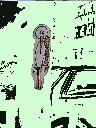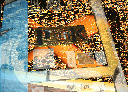|
Axel 1 Es war nachts, ich erinnere mich
nicht mehr genau an den Tag. Vielleicht war es Wochenende. Ja, am nächsten Tag
hatte ich frei. So kam es, dass ich mitten in der Nacht auf dem Nachhauseweg
war. Alexander 1 Heiligabend hatte Sandra mit mir Schluss gemacht, der Arm war gelähmt, die Wohnung hatte ich tobsüchtig kurz und klein getreten. Der Alkohol. Wie immer zuviel. Das war mein Problem. Nicht mehr Sandras. Hatte ich es erwähnt? Sandra hatte Schluss gemacht. Gut, das ich heute in die Kirche gegangen war. Bruder John hat mich aufgebaut. Obwohl ich wieder auf Schore war. Der Afrikaner hat es sofort erkannt. Hat aber
nicht die Augen verdreht. Er kannte das schon. Er war froh, dass ich da war.
Besser als im Knast. Oder in der Gosse. Rudi hatte ich auch mitgenommen. War ein
Fehler gewesen, hatte ich später gedacht. Bruder John dachte anders. Trotzdem
war es mir peinlich, als Rudi rief, wann es endlich zu essen gäbe. Mitten im
Lied, als alle sangen. Die Afrikaner um uns herum schwiegen. Betreten oder
beleidigt. Vielleicht auch mitfühlend. Sie sahen uns an. Nein, sie starrten uns
an. Erkannten uns Junkies. Ich hielt den Mund. Wurde ganz klein. Rudi nicht. Er
krakeelte. Junkies, so sind die halt. Durch und durch unberechenbar. Aber ich
bin ja gar keiner mehr. Fix nur manchmal. Alle hörten auf zu singen. Da wurde
Rudi leise. Zu spät, hatte ich gedacht. Aber wir waren drauf. Bruder John hatte
es gemerkt. Und alle anderen auch. Es gab nichts zu verheimlichen. Bruder John
unterbrach die unselige Stille: „Brüder und Schwestern“, rief er, „seht hier:
Arme, die der Hunger treibt. Helft ihnen.“ Dann drei Halleluja. Er ging herum
und sammelte eine Kollekte. Nur für Rudi und mich. Das war genau das richtige.
Rudi griff mit vollen Händen zu. Ich nicht. Das Geld brannte nicht auf meiner
Seele. Nein, es war der Schmerz meiner Einsamkeit. Und diese Flammen löschte die
Gemeinschaft. Und während ich Rudi beobachtete, wie er das Geld ohne zu zählen
in seine Taschen verstaute, überkam mich das wohlige Gefühl mein Leben halbwegs
im Griff zu haben. Ich hatte eine Wohnung, regelmäßiges Geld vom Amt und das
Heroin unter Kontrolle. Die andere Hälfte: Sandra, Alkohol, Behinderung.
Behinderung: Die Straßenbahn schoss vor mein inneres Auge. Der Zusammenstoß,
mein Sturz, der Schmerz. Ich hätte Tod sein können. Als ich im Krankenhaus war,
entgiftet und halbseitig gelähmt, war ich das erste Mal froh am Leben zu sein.
Meine Lebensmüdigkeit war dem Lebensmut gewichen. Da blühte ich auf. Und dann
lernte ich Sandra kennen. Sie war Krankenschwester, ich Patient. Der Frühling
kam und sie half mir in mein neues Leben. Eine Zeit lang ging es sogar ohne
Alkohol. Und ohne Schore. Im Herbst trank ich wieder. Sandra akzeptierte es
zuerst widerwillig. Bis ich austickte. Dann der Frust.
Andreas 1 Ich hielt seine schlaffe, einst so kräftige Hand. Er war ohnmächtig. Genauer komatös. Geräte piepten. Seine Augen waren blau geschlagen. Ich sah ihn wieder an und heulte weiter. Sie hatten ihn abgestochen. Mit dem Messer in beide Nieren. Ich erinnerte mich daran, wie er es mir gezeigt hatte. Im Schlachthaus. Ich war zehn gewesen und er hatte es mir gezeigt. Knie in die Eier. Beide Hände um den Körper und die Messer schräg nach oben. Wir hatten es geübt, immer und immer wieder. Von klein auf lehrte er mich Sandsäcke auf den Schultern zu tragen. Lehrte mich zu kämpfen. Ich sollte seine Nachfolge antreten. Präsi sollte aus mir werden.
Hart sollte ich sein. Und jetzt heulte ich rum. Er lag wie tot da. Konnte nichts sagen. Hatte einen Schlauch im Mund. Und beide Nieren zerstochen. Ich war vollkommen fertig. War gerade noch im Jugendknast gewesen. Heiligabend im Knast. Die volle Packung. Wir waren alle cool. Aber innen drin, da sah es übel aus. Zuhause hatte Andrea mir alles erzählt. Lukas ist im Krankenhaus. Da habe ich nicht gewartet. Bin sofort aufs Fahrrad und losgefahren. Aus der Stadt, in die nächste Stadt und über die Landstraße. Wut und Trauer trieben mich fünfzig Kilometer durch den Winter. Im Krankenhaus ging ich zu ihm. Konnte nichts machen. Die Krankenschwester versuchte mich zu trösten. Bis sie keine Zeit mehr hatte. Ob er sterben würde? Mit sechzehn konnte ich nicht sein Nachfolger werden. Konnte kein Rind auf den Schultern tragen, konnte keine Kiste Bier trinken, konnte dem fetten Andy keins auf die Glocke geben. Ich war zu jung, zu klein, zu schwach. Und ich heulte, weil ich nicht wusste, ob mein Vater den nächsten Tag erleben würde. Axel 2 Es war schon lange her, dass Lichtkegel Schneewehen zerschnitten hatten. Mir war kalt. Vielleicht sollte ich ein Taxi nehmen. Aber es kam keins. Stattdessen hörte ich ein seltsames Geräusch. Schwieep-wumm. Es wiederholte sich öfter. Unter einer Lampe sah ich einen Mann, der seltsam gebückt eine große Kiste schob. Unwillkürlich dachte ich an Quasimodo, der Leichen im Schutze der Nacht raubte. Schwieep-wumm. Das Schwieep kam vom Schieben. Der Mann war auf der anderen Straßenseite. Seitlich gebeugt humpelte er. Sein linkes Bein zog er kraftlos nach und sein Arm hing hinunter. Ich wechselte die Seite, um ihn zu helfen. Oder zumindest fragen, was er da seltsames tat. Alexander 2
Andreas 2 Die Krankenschwester schickte mich weg. Du musst jetzt gehen, sagte sie. Ich gehorchte ihr. Ging hinaus und setzte mich aufs Fahrrad. Jetzt war es dunkel. Verschwunden die Sonne, die mich mittags gewärmt hatte. Ich war in der kleinen Stadt und musste nach Hause. Keine S-Bahn, kein Bus, kein Geld. Also fuhr ich los. Aus der kleinen Stadt auf die Landstraße. Nicht mal zehn Minuten unterwegs, … und dann fing es an zu schneien. Dichter Schnee peitschte mich an. Ich hatte Glück, weil er von hinten kam und ich hatte Pech, weil ich noch immer die Klamotten trug, mit denen ich im Jugendknast herumgehangen hatte. Herbstkleidung. Ich fror. Also fuhr ich schneller. Die Hände steckte ich in die Taschen. Immerhin ging das Vorderlicht. Sonst hätte ich nichts mehr gesehen. Zwei Stunden. Mindestens zwei Stunden noch. Dann wäre ich zu Hause. Wie sehr hasste ich den Mann, der meinen Vater so zugerichtet hatte. Ich dachte darüber nach, wer das getan haben könnte. Wegen ihm ging es Lukas so schlecht. Wegen ihm fuhr ich durch den Schnee und fror. Wut und Rache erhitzten mich. Sie trieben mich an. Ich fuhr schneller, so schnell, wie es freihändig eben ging. Immerhin hatte ich Rückenwind. Axel und Alexander „Kann ich Dir helfen?“, sprach der Großstädter den Junkie an. Der Junkie drehte sich um und nahm dankend an. So standen sie voreinander. Und in ihren Augen funkelte Sympathie. Ungeachtet unterschiedlicher Pupillengrößen. Der Großstädter ging hinten, der Junkie vorne und nach fünf Minuten war es geschafft. Der Junkie bedankte sich, doch der andere sah, dass der Junkie noch ein paar Stufen zu gehen hatten. „Trägst Du die Box auf dem kleinen Finger in den Keller?“, fragte er und grinste. Der Junkie guckte blöd und der andere bot erneut Hilfe an, die wiederum bereitwillig angenommen wurde. Im Keller lagen zehn Euro, ein Computermonitor, eine Schatzkiste, tausende Zeitungen, ein Keyboard, leere und volle Bierflaschen. Der Einarmige bot seinem Helfer ein Bier an. Der bedankte sich, doch er lehnte ab, denn er machte sich nichts aus Alkohol. Dafür aber umso mehr aus einem netten Plausch. Das war auch angenehm und so gingen die beiden wieder hinaus in den Schnee und setzten sich in den Schutz einer Bushaltestelle, um den Schneesturm zu betrachten. Dabei unterhielten sie sich prächtig über Gott, die Welt, schöne Frauen, schnelle Autos, Straßenleben, Drogen, Ungerechtigkeit, Luden und Politik. Der Junkie klagte zwischen den Sprüngen, die das Gespräch belebten, über seine tragischen Erlebnisse der letzten Zeit, die ihnen als aufmerksamer Leser bekannt sind und der andere munterte ihn mit netten unbeschwerten Episoden auf oder verwies auf schlimmeres Unglück. Dabei wurde Bier getrunken, die eine oder andere Zigarette geraucht und Kaugummi gekaut. Andreas 3 Endlich Stadt. Oder zumindest das Schild, das die Stadt
anzeigte Axel, Alexander und Andreas „Das ist noch
weit, weit weg.“, antworteten die beiden erstaunt aus ihrer Unterhaltung
gerissen. Sie betrachteten den jungen Radfahrer. Ein Kind im Schneesturm. Dünn
gekleidet und durchgefroren sah von Martin Teuschel
|
|
| ||||||||||||||